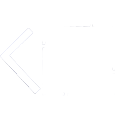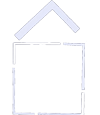TAGEIN TAGAUS BERLIN
10. Januar 2005. Die Marillen und Feigen, der Wein, Sonne und Mond, die Musik und der weibliche Bauch, das alles kommt vom Osten, und ich wählte als Endstation meiner Bahnfahrt von Bozen nach Berlin nicht den Bahnhof Zoologischer Garten, sondern Berlin Ostbahnhof.
11.1. Es sollte eine fröhliche und herzliche Stadt sein, eine weitmaschige, lesbische, schwule Stadt, mitten in der Zeit, Ost und West sollte sie vertreten, unten und oben lebendig sein. Eine Stadt mit Gedächtnis, mit Erinnerungsvermögen, deshalb Berlin. Mich interessiert aber nur die Kunst: der Höhenflug, der Absturz, die gescheiterten Utopien, die Löcher im Grundmuster, im Gedächtnis. Ein Lochstreifen, eine Lochpartitur: Kann faschistische Architektur gute Architektur sein? Warum nicht? Können uns die Erkenntnisse der nationalsozialistischen Wissenschaftler hilfreich sein? Welche Kriterien des Wertmaßstabes sind ungültig?
12.1. Wie einzelne Lebewesen Hormone ausschütten, im Frühling, im Sommer, so schüttet ein urbaner Organismus Wellen und Ströme aus. Niemand weiß, warum eine Stadt so aussieht, wie sie aussieht, so riecht, so stinkt, so lockt, so verdirbt, so zärtlich ist. Jede Stadt hat eine eigene Geschwindigkeit, eine Gravitation, Feuchtigkeit, Strömung und Gegenströmung, ähnlich der eines Flusslaufes, mit Strudeln und Wirbeln, Ufern, an denen das Wasser reibt und nagt. Immer strömt frisches Wasser nach, jeden Tag ist alles neu, alles anders, aber doch wieder gleich, fast gleich, fast ähnlich. Nichts gibt es, das in einer Stadt nicht passierte, und wenn nichts passiert, dann könnte etwas passieren. Irgendetwas Wichtiges passiert immer. Berlin ist eine Hauptstadt des Höhenfluges und des Unterganges, des Zerfalls der Poesie und der Kochkunst, und genau diese Stadt schien mir geeignet dafür, mich des Gegenwärtigen zu versichern. Zu Anfang kann ich das Ende gleich vorwegnehmen, das ändert nichts am Verlauf: Keine Stadt hat mich mehr ausgezehrt und zugleich zärtlicher und freundlicher behandelt als Berlin. In den Straßen, in den Cafés, zwischen den Häusern, am Ufer des Wassers war ich gut aufgelegt, zwischen der Kunst und im Bett schlief ich gern, und noch lieber stand ich morgens auf. Die Menschen sprachen mit mir. Hier wird nicht gesungen und nicht gekocht, hier findet die Sprache statt, ohne Sentimentalität, ohne Gutmütigkeit. Die Sprache ist hier am Ort. Nicht um ihrer selbst willen, wie anderenorts, sondern um zu benennen, zu unterscheiden, sie hat keinerlei Fluchtmöglichkeit, kein Versteck.